 Störlichtbogen
Störlichtbogen
Rechtlicher Hinweis & Haftungsausschluss
Alle Informationen zum Lichtbogenschutz dienen ausschließlich der allgemeinen technischen Orientierung. Sie ersetzen keine Gefährdungsbeurteilung, keine Fachplanung und keine Beratung durch qualifizierte Elektrofachkräfte. Trotz sorgfältiger Recherche wird keine Gewähr für Vollständigkeit, Richtigkeit oder Aktualität übernommen. Änderungen von Normen, Gesetzen und technischen Regeln sind jederzeit möglich. Für Schäden oder Entscheidungen, die aus der Nutzung dieser Informationen entstehen, wird keine Haftung übernommen. Arbeiten an elektrischen Anlagen dürfen ausschließlich von befähigten Elektrofachkräften durchgeführt werden.
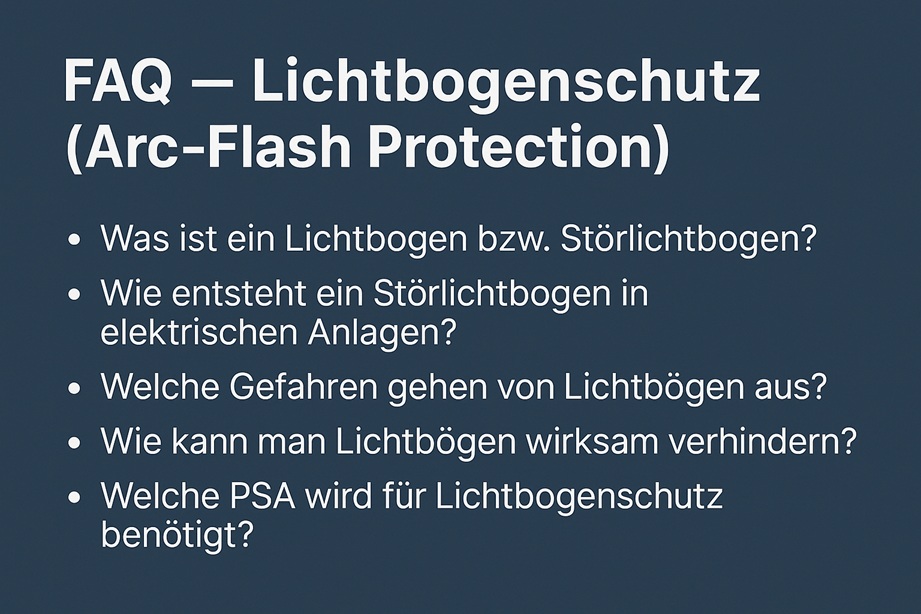 FAQ Lichtbogenschutz / Arc-Flac Protection
FAQ Lichtbogenschutz / Arc-Flac Protection
1. Was ist ein Lichtbogen bzw. Störlichtbogen?
Ein Lichtbogen ist eine ungewollte elektrische Entladung zwischen Leitern oder zwischen einem Leiter und geerdeten Bauteilen. Ein Störlichtbogen entsteht, wenn diese Entladung ungeplant und unkontrolliert erfolgt. Er zählt zu den gefährlichsten Ereignissen in elektrischen Anlagen und kann innerhalb von Millisekunden extreme Hitze, Druckwellen und schwere Anlagenschäden verursachen.
2. Wie entsteht ein Störlichtbogen in elektrischen Anlagen?
Typische Auslöser sind:
- beschädigte oder gealterte Isolation
- lose oder schlecht befestigte Kontakte
- Verschmutzung, Staub, Feuchtigkeit oder Kondensat
- metallischer Fremdkörper im Schaltschrank
- Schaltfehler oder Werkzeugkontakt
- Kurzschlüsse und Fehlerströme
- unsachgemäße Arbeiten unter Spannung (AuS)
3. Welche Gefahren gehen von Lichtbögen aus?
Ein Lichtbogen erzeugt in kürzester Zeit:
- Temperaturen von über 10.000 °C
- Druckwellen und Explosionseffekte
- toxische Rauchgase
- brennende Partikel und Funkenflug
- Zerstörung von Schaltgeräten und Transformatoren
- schwere Verbrennungen und lebensgefährliche Verletzungen für Personal
4. Wie kann man Lichtbögen wirksam verhindern?
Die Vermeidung folgt dem TOP-Prinzip (Technisch – Organisatorisch – Persönlich):
Technische Maßnahmen
Organisatorische Maßnahmen
- Gefährdungsbeurteilung und Risikoanalyse
- klare Arbeitsanweisungen, Freischaltregeln
- qualifiziertes Personal
- regelmäßige Inspektion und Wartung
Persönliche Maßnahmen
- PSA gegen Störlichtbögen (Schutzklasse 1 oder 2)
- Gesichtsschutz, Handschuhe, Lichbogenschutzarbeitskleidung
- angepasste Schutzausrüstung bei AuS-Arbeiten
5. Worin unterscheiden sich Lichtbogenschutz und klassischer elektrischer Schutz?
Klassische Schutzfunktionen (z. B. Überstrom, Erdfehler, Differenzschutz) reagieren auf elektrische Größen.
Lichtbogenschutzsysteme reagieren zusätzlich auf optische Signale, Blitzlicht und Druckanstieg — und lösen extrem schnell aus.
Die beste Lösung ist die Kombination aus Stromerkennung + optischer Detektion mittels .
6. Welche Schutzrelais können zur Erkennung von Lichtbögen beitragen?
Viele Schutzrelais erkennen Fehler, die einen Lichtbogen auslösen können, darunter:
- Überstromrelais
- Differenzialrelais
- Erdfehlerrelais
- Thermische Schutzfunktionen
- Spannungs- und Frequenzschutz
In Kombination mit optischen Sensoren entsteht ein vollständiges Lichtbogenschutz-System.
7. Welche Rolle spielt die Lichtbogenerkennung in Schaltanlagen?
Sie dient dazu, Lichtbögen innerhalb weniger Millisekunden zu detektieren und abzuschalten.
Das reduziert:
- Lichtbogenenergie
- Brandschäden
- Stillstandzeiten
- Reparaturkosten
- Verletzungsrisiken
In modernen Industrie- und Energieanlagen ist diese Technologie Standard.
8. Wo treten Lichtbögen besonders häufig auf?
- Niederspannungs- und Mittelspannungsschaltanlagen
- Transformatorstationen
- Rechenzentren und Serverräume
- Industrieanlagen und Produktion
- Bahntechnik (16,7 Hz und 50 Hz Netze)
- Windkraft- und PV-Anlagen
- Baustellenverteiler und temporäre Stromnetze
9. Welche Normen und Standards sind für Lichtbogenschutz relevant?
Wichtige Regelwerke sind u. a.:
- DGUV Vorschrift 3
- DIN EN 61482 (PSA gegen thermische Gefahren)
- IEC 61482-2 (Arc Flash PPE)
- IEC 62271-200 / -202 (Bauweise von Schaltanlagen)
- IEC 60947 (Schaltgeräte)
- Arbeitsschutzgesetz (Gefährdungsbeurteilung)
- Maschinenrichtlinie
- IEC/IEEE-Empfehlungen für Kurzschluss- und Netzschutz
10. Welche PSA wird für Lichtbogenschutz benötigt?
Persönliche Schutzmaßnahmen umfassen:
Die erforderliche Schutzklasse ergibt die Gefährdungsbeurteilung.
11. Können Lichtbogenschutzsysteme Schäden vollständig verhindern?
Sie reduzieren Lichtbogenenergie drastisch, können aber Schäden nie zu 100 % verhindern. Je schneller die Abschaltung (idealerweise unter 10 ms), desto geringer:
- thermische Zerstörung
- Reparaturaufwand
- Ausfallzeiten
- Gefährdung des Personals
12. Wie kombiniert man Netzschutz und Lichtbogenschutz optimal?
Eine wirksame Kombination besteht aus:
- Strommessung (z. B. Überstrom, Differenzial)
- Optische Sensorik (Lichtdetektoren im Schaltschrank)
- Extrem schnellen Schaltvorgängen
- Mechanisch robustem Anlagendesign
Diese Kombination schützt sowohl Transformatoren, Kabel, Schaltgeräte als auch Personal.
13. Welche Branchen benötigen zwingend Lichtbogenschutz?
Besonders relevant ist er für:
- Energieversorger (EVU, Netzbetreiber)
- Rechenzentren (Uptime-relevanter Schutz)
- Industrieproduktion
- Chemische Industrie
- Bahn- und Verkehrstechnik
- Gesundheitswesen und Kliniken
- öffentliche Einrichtungen
- Infrastruktur und Gebäudetechnik
14. Warum wird Lichtbogenschutz in Rechenzentren immer wichtiger?
Rechenzentren besitzen:
- extrem hohe Stromdichten
- eng bebaute Schaltanlagen
- redundante Energieversorgung
- enorme wirtschaftliche Risiken bei Ausfall
Ein Störlichtbogen führt zu:
- sofortigen Teilausfällen
- hohen Reparaturkosten
- Betriebsunterbrechung trotz Redundanz
- Image- und SLA-Schäden
Daher gehört Arc-Flash-Protection heute zur Standardplanung großer RZ-Projekte.
15. Wie reduziert eine Lichtbogenschutzlösung die Abschaltzeit?
Optische Sensoren erkennen die Lichtemission in Mikrosekunden.
Schutzrelais leiten anschließend millisekundenschnelle Abschaltungen ein.
Je kürzer die Lichtbogenenergie wirkt, desto geringer sind:
- Schmelzschäden an Kupfer/Aluminium
- Gehäuseschäden
- Risiken für Personen
- Brandfolgen
- Shutdown-Zeiten
16. Wie oft sollte eine Anlage auf Lichtbogenrisiken geprüft werden?
Empfohlen wird:
- jährliche Sichtkontrolle
- vollständige Prüfung alle 3–5 Jahre
- Prüfung nach Umbau, Erweiterung oder Störung
- regelmäßige Reinigung und Thermografie-Checks
17. Übernimmt ein Lichtbogenschutzsystem auch die Aufgaben eines Schutzrelais?
Nein.
Ein Lichtbogenschutzsystem ergänzt, ersetzt aber nicht:
- Überstromschutz
- Erdfehler- und Differenzialschutz
- Spannungsschutz
- Netzschutzfunktionen
- Transformator- und Motorenschutz
Beide Systeme arbeiten gemeinsam für maximale Sicherheit.
18. Wie wird die notwendige PSA-Schutzklasse bestimmt?
Über eine Gefährdungsbeurteilung, basierend auf:
- Netzkurzschlussleistung
- Arbeitsverfahren
- Anlagenspannung
- räumliche Gegebenheiten
- Leistungsgrenzen der PSA
19. Was kostet eine Lichtbogenschutzlösung?
Die Kosten hängen ab von:
- Anlagengröße
- Spannungsniveau
- Art der Sensorik
- Anzahl der Felder
- geforderter Auslösezeit
- PSA und organisatorischem Aufwand
Typische Preisspanne (grob):
- Sensorik + Relais pro Feld: mittelpreisig
- komplette Systeme in MS-Anlagen: projektabhängig
20. Wann ist ein vollständiges Arc-Flash-Protection-System besonders empfehlenswert?
Wenn folgende Bedingungen vorliegen:
- hohe Verfügbarkeit notwendig (RZ, Industrie, Infrastruktur)
- erhöhte Staub- oder Feuchtigkeitsbelastung
- enge oder komplexe Schaltschränke
- alte Anlagen mit zunehmenden Kontaktproblemen
- viele manuelle Schalthandlungen
- hoher Energiedurchsatz und hohe Kurzschlussleistung
 Folgen eines Lichtbogens
Folgen eines Lichtbogens
Bidlquelle: Wikipedia
